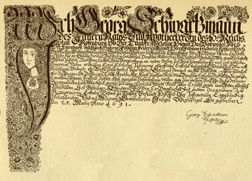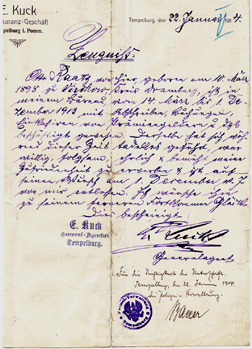Ursprünge des Arbeitszeugnisses
Arbeitszeugnisse, wie wir sie heute kennen, sind das Ergebnis einer rund 500-jährigen Entwicklung. An deren Anfang standen Urkunden mit Namen wie "Abschied", "Kundschaft" oder "Pasport", die Beschäftigte bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses erhielten und bei Antritt eines neuen Arbeitsverhältnisses vorzulegen hatten. Ausgestellt wurden solche Urkunden hauptsächlich für mobile Arbeitnehmer: Beschäftigte in Haushalten und in der Landwirtschaft ("Gesinde" genannt), Bergleute und Handwerksgesellen. Dementsprechend finden sich die ältesten Bestimmungen zur Zeugnisausstellung in Gesinde- und Zunftordnungen wie z.B. in der Gesindeordnung für Hildesheim, Braunschweig und Lüneburg von 1445 oder der Salzburger Bergordnung von 1532.[1]
Entwicklung der Arbeitnehmer-Beurteilung
Diese Vorläufer des Arbeitszeugnisses enthielten kurze Angaben zur Person, zu Art und Dauer der ausgeübten Tätigkeit und zur ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Sie wurden vom Arbeitgeber oder in dessen Auftrag von einem Schreiber ausgestellt und häufig polizeilich beglaubigt. Die wichtigste Aussage in einer solchen Urkunde war die Bestätigung des Arbeitgebers, dass das Arbeitsverhältnis ordentlich beendet worden war. über die Jahrhunderte wurden zunehmend auch Verhalten und Leistung beurteilt; eine dementsprechende Vorschrift ist bereits in der Gesinde-Tagelöhner- und Handwercks-Ordnung für Sachsen von 1651[2] enthalten. Das besonders kunstvoll gestaltete Testimonium (lateinisch für "Zeugnis") eines Apothekergesellen von 1691, welches in der rechten Spalte auf dieser Seite abgebildet ist, beurteilt das Verhalten ("Dienstbar, Auffrichtig Und Redlich"), die Fachkenntnisse ("Kunsterfahrne") und bescheinigt eine ordnungsgemäße Beendigung des Arbeitsverhältnisses ("güttliche Dimission").
Das Zeugnis als Machtinstrument
Zeugnisse wurden zunächst hauptsächlich im Interesse der Arbeitgeber und Behörden ausgestellt. Ihr Zweck war es, Bergwerksbetreiber, Handwerksmeister und andere Dienstherren vor unehrlichen oder vertragsbrüchigen Beschäftigten zu schützen und die Wanderbewegungen mobiler Arbeitnehmer zu kontrollieren. Dementsprechend wurden diese Beurteilungen in den meisten Fällen knapp, kühl, floskelhaft und von "oben herab" formuliert. Eine Tradition, die noch heute in manchen Zeugnis-Formulierungen lebendig ist. Wenn einem qualifizierten Arbeitnehmer des 21. Jahrhunderts z.B. eine "rasche Auffassungsgabe", ein "einwandfreies Verhalten" und eine gute "Erledigung der übertragenen Aufgaben" bescheinigt wird, verweist der etwas antiquiert und unpassend wirkende Sprachgebrauch auf die jahrhundertelange Beurteilung von Knechten durch ihre Herren.
Einfluss des Empfehlungsschreibens
Allerdings zeigt das bereits erwähnte und rechts abgebildete Zeugnis eines Apothekergesellen, dass solche Urkunden durchaus auch aufwändig gestaltet und besonders wohlwollend formuliert werden konnten. Je mehr Bildung und Ansehen der zu Beurteilende besaß, desto stärker orientierten sich Aussteller von Zeugnissen bei der Formulierung an Empfehlungsschreiben, die bereits seit der Antike in gebildeten Kreisen gebräuchlich waren. Dementsprechend enthält das Zeugnis des Apothekergesellen eine ausdrückliche "Recommendation" (Empfehlung) des Unterzeichners – als Ausdruck der Zufriedenheit des Apothekers mit seinem Gesellen, aber auch als Ausdruck der gesellschaftlichen Stellung eines Apothekergesellen im Jahr 1691, als Arzneimittel noch überwiegend direkt in der Apotheke hergestellt wurden. Noch heute ist es so, dass mit zunehmender Qualifikation und Verantwortung von Arbeitnehmern deren Zeugnisse individueller und wohlwollender formuliert werden und manchmal sogar Lob und Empfehlungen enthalten. Arbeitnehmer in den unteren Hierarchieebenen müssen sich dagegen häufiger mit nichtssagenden Textbausteinen begnügen.
Entwicklung der wohlwollenden Beurteilung
Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus dem Kontroll- und Disziplinierungsinstrument ein Beurteilungsinstrument, welches auch dem beruflichen Weiterkommen der Arbeitnehmer diente. Im Zuge der Aufklärung wurde im 18. Jahrhundert der Wohlwollensgrundsatz zu einer Richtlinie der Zeugnisschreibung. Gesindeordnungen, wie z.B. die revidierte "Gesinde-Ordnung fuer das platte Land des Herzogthums Cleve, und der Graffschaft Marck" von 1769, enthalten nun auch Vorschriften, um das Gesinde vor böswilligen und ungerechten Beurteilungen zu schützen.[3] Genau 100 Jahre später trat die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes in Kraft und schuf die Grundlage für den Rechtsanspruch auf ein Arbeitszeugnis, wie wir ihn heute kennen.[4] Und nachdem 1890 auf der Internationalen Arbeiterschutzkonferenz in Berlin umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschlossen worden waren, wurde die Gewerbeordung des Deutschen Reiches durch das Arbeiterschutzgesetz von 1891 ergänzt.[5] Damit wurde das Recht auf eine Leistungsbeurteilung im Zeugnis eingeführt und zugleich eine "Kennzeichnung des Zeugnisses, die bewirkt oder bewirken soll, dass die Arbeiter in ihrem Fortkommen behindert werden", verboten.[6] Ein solches Verbot findet sich in der heutigen Gewerbeordnung in § 109 (2).
Formalisierung der Zeugnissprache
In den letzten hundert Jahren haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Zeugnisausstellung nur wenig verändert, wohl aber die Praxis der Zeugnisschreibung. Bis in die 1960er Jahre wurde eher knapp und überwiegend im Klartext formuliert, wobei der Grad der Zufriedenheit bereits durch die bekannten Zufriedenheitsformeln zum Ausdruck gebracht wurde.[7] Ab den 1970er Jahren führten dann die zunehmende öffentliche Diskussion über "Zeugniscodes" sowie die Verbreitung von Ratgeberliteratur zu einer weiteren Formalisierung der Zeugnissprache. Zunehmend wurden Leistungsaussagen mit Schulnoten verknüpft und in dieser Form als Textbausteine verbreitet. Das Aufkommen von Software zur Zeugniserstellung hat diesen Trend weiter verstärkt und dazu geführt, dass die Bedeutung des Arbeitszeugnisses als Beurteilungs- und Auswahlinstrument abgenommen hat. Dass ein Arbeitszeugnis aber nach wie vor für viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber mehr ist als ein unwichtiges Stück Papier, zeigen die jährlich rund 30.000 Verfahren vor Arbeitsgerichten, die alleine in Deutschland wegen Zeugnissen geführt werden. In diese Streitigkeiten kommt nach wie vor das Ringen zwischen gesellschaftlichen Kräften zum Ausdruck, welches seit rund 500 Jahren die Praxis der Zeugnisausstellung und die Debatte über Zeugnisse prägt.
Quellen & Anmerkungen
- ⇑
Gunter Presch: "Verdeckte Beurteilungen in qualifizierten Arbeitszeugnissen. Beschreibung, Erklärung,
Änderungsvorschläge". In: Politische Sprachwissenschaft. Zur Analyse von Sprache als kultureller Praxis.
Hg. Franz Januschek. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985. S. 338. Sowie: Monika Huesmann: Arbeitszeugnisse aus
personalpolitischer Perspektive. Wiesbaden: Gabler Verlag, 2008. S. 22, 25.
- ⇑
Presch S. 341.
- ⇑
Vgl. Huesmann S. 29, Presch S. 346, Rainer Schröder: "Gesinderecht im 18. Jahrhundert". In: Gesinde im 18. Jahrhundert. Hg. Gotthardt Frühsorge. Hamburg: Meiner
Felix Verlag, 1995. S. 31.
- ⇑
Hein Schleßmann: Das Arbeitszeugnis. 19. Auflage. Frankfurt am Main: Verlag Recht und Wirtschaft, 2009.
S. 21. Eine entsprechende Regelung wurde später – für alle abhängig Beschäftigten – im
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert, das 1900 in Kraft trat.
- ⇑
Landmann / Rohmer: Gewerbeordnung. 57. Ergänzungslieferung 2010. C. H. Beck Verlag.
(Laut Online-Recherche am 04.04.2011.)
- ⇑
Blos, Wilhelm: Denkwürdigkeiten eines Sozialdemokraten. München: Verlag G. Birk & Co., 1914. S. 271-282. Siehe auch § 113. der Gewerbeordnung
von 1891 auf
Wikisource (Online-Recherche am 22.04.2011.)
- ⇑
Die Entwicklung der Zeugnisschreibung und die Bedeutung der Zufriedenheitsformel lassen sich anhand der
historischen Original-Zeugnisse auf der Info-Seite "Historische Arbeitszeugnisse"
gut nachvollziehen.
- ⇑
Annalen der Preußischen Innern Staatsverwaltung. Herausgegeben von K. A. von Kamptz.
Zwölfter Band Jahrgang 1828, Erstes Heft: Januar bis März. S. 139-140.

 0176 34 77 66 89
0176 34 77 66 89